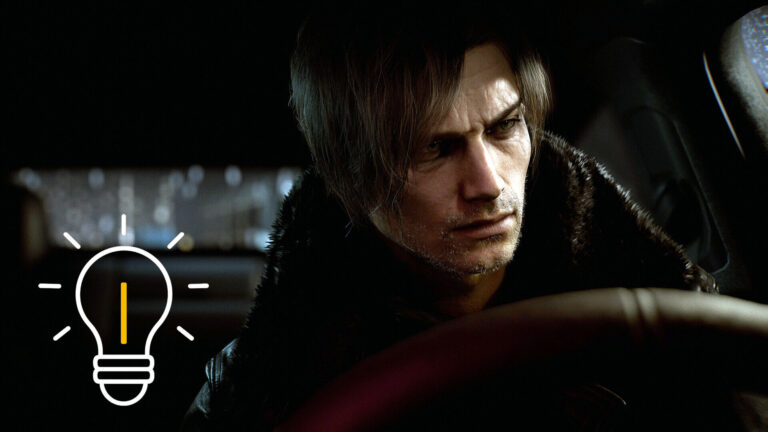Welche Rolle spielen psychologische Grundbedürfnisse beim Gaming – und was passiert, wenn sie nicht erfüllt werden? Zwei Studien geben darauf differenzierte Antworten.
Was macht ein Spiel eigentlich „gut“ – und warum fühlt es sich manchmal trotz ausgefeilter Grafik, flüssiger Steuerung und spannender Handlung einfach falsch an? Die Antwort liegt womöglich tiefer als gedacht: in der Frage, ob ein Spiel zentrale psychologische Bedürfnisse erfüllt oder verletzt. Zwei Studien zeigen, wie stark Erfahrungen von Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit das Spielgefühl prägen und welche Folgen es hat, wenn genau diese Bedürfnisse frustriert werden. Besonders spannend: Gerade in Krisenzeiten greifen viele Menschen zu Spielen in der Hoffnung auf Ausgleich – doch das klappt nicht immer.
Frust statt Flow: Wenn Spiele Bedürfnisse verletzen
Wer sich beim Spielen jemals gezwungen fühlte, eine bestimmte Strategie zu verfolgen, obwohl sie keinen Spaß machte, kennt das: Frust statt Freiheit. Genau solche Erfahrungen haben Forschende im Rahmen zweier Studien unter die Lupe genommen und liefern dabei eine differenzierte Bestandsaufnahme, wann Videospiele guttun können und wann sie eher belasten. Die Analysen stammen aus einer Dissertation, die sich mit dem Spannungsfeld zwischen Bedürfnisbefriedigung und -frustration im Gaming beschäftigt.
In Kapitel 6 („What Does Need Frustration in Games Look Like?“) geht es zunächst um den Frust: Laut der Autorin erinnern sich viele Menschen deutlich an Spielsituationen, in denen sie sich in ihrer Autonomie, Kompetenz oder sozialen Eingebundenheit eingeschränkt fühlten – also in genau jenen drei Bedürfnissen, die laut der psychologischen Selbstbestimmungstheorie zentral für Motivation und Wohlbefinden sind.
Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit – und was passiert, wenn sie fehlen
Autonomiefrust entsteht etwa, wenn euch das Spiel zwingt, auf eine Weise zu agieren, die euch nicht entspricht – sei es durch starre Spielsysteme, durch andere Mitspielende oder durch äußeren Druck wie Strafen bei Fehlverhalten im Multiplayer. Kompetenzfrust wiederum tritt auf, wenn ihr das Gefühl habt, nicht voranzukommen, ungerechte Hürden überwinden zu müssen oder Entscheidungen zu treffen, die keinerlei Auswirkungen haben. Und beim Thema soziale Eingebundenheit wird es besonders vielschichtig: Manche berichteten von toxischen Mitspielenden, andere fühlten sich von der Spielwelt selbst entfremdet oder hatten das Gefühl, nicht zur Community dazuzugehören.

Ein zentraler Befund: Frust ist nicht einfach das Gegenteil von Erfüllung, sondern ein eigenes Phänomen mit spezifischen emotionalen Folgen. Wer sich in seinen Bedürfnissen frustriert fühlt, reagiert meist mit Vermeidungsverhalten: Spielabschnitte werden übersprungen, es wird pausiert oder gleich komplett aufgehört. Gleichzeitig kann extrinsische Motivation – zum Beispiel der Wunsch, mit Freunden mitzuhalten oder Belohnungen zu kassieren – dazu führen, dass ihr trotz Frust weiterspielt.
Kompensation durch Gaming? Nur manchmal
Die zweite Studie (Kapitel 7: „Do People Use Games to Compensate for Frustrated Needs During Crises?“) zeigt, dass Spiele durchaus als Mittel zur Kompensation dienen können – etwa in belastenden Lebensphasen wie dem Lockdown. Viele beschrieben, wie sie in Spielen Kontrolle, Fortschritt oder soziale Nähe fanden, die ihnen im Alltag fehlten. Games wurden zur Ausflucht, zum Übungsfeld für Selbstwirksamkeit oder zum Ort der Verbundenheit.
Auch interessant:
Doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte: Wer im echten Leben bereits zufrieden ist, berichtet auch von erfüllenderen Spielerfahrungen. Wer hingegen im Alltag frustriert ist, erlebt auch im Spiel seltener Bedürfnisbefriedigung. Ein möglicher Grund: Menschen mit niedrigem Wohlbefinden nutzen Spiele zwar zur Kompensation, erleben sie aber nicht als wirksam, etwa weil sie sich für ihre Spielzeit schämen, das Medium nicht ernst nehmen oder durch obsessive Spielmuster das Gegenteil von Zufriedenheit erreichen.
Erwartungen als Stolperstein
Denn Erwartungen sind ein Schlüssel: Frust entsteht oft dann, wenn ein Spiel nicht das hält, was ihr euch erhofft habt. Wenn ihr etwa denkt, das Spiel lasse euch freie Wahl, euch dann aber in ein Korsett aus Regeln zwängt. Oder wenn ihr auf soziale Interaktion hofft, aber nur Toxizität erntet. Die Folge: Ihr passt euer Verhalten an, spielt anders – oder gar nicht mehr.
Kurz gesagt: Spiele können sowohl Rückzugsort als auch Frustfalle sein. Entscheidend ist, wie gut sie eure Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, Wirksamkeit und Verbundenheit erfüllen und wie sehr ihr ihnen das auch zutraut. Wer Design, Forschung oder psychologische Begleitung im Gaming-Kontext ernst nimmt, sollte also nicht nur auf das schauen, was gut läuft. Sondern auch auf das, was weh tut.
Studie: The Basic Needs in Games Model of Video Games and Mental Health by Nic Ballou